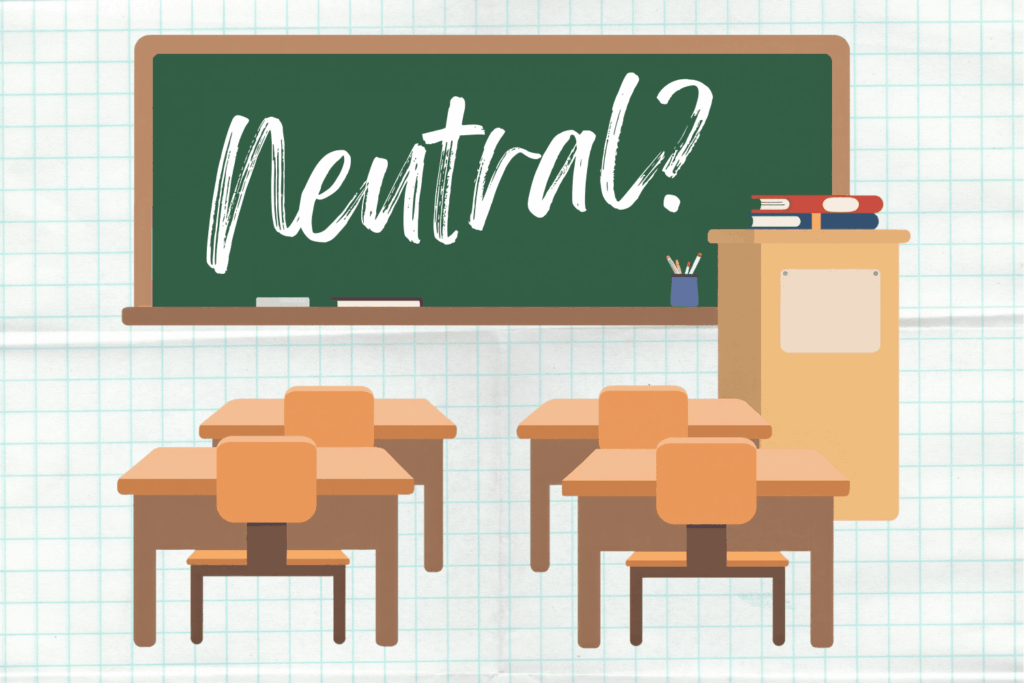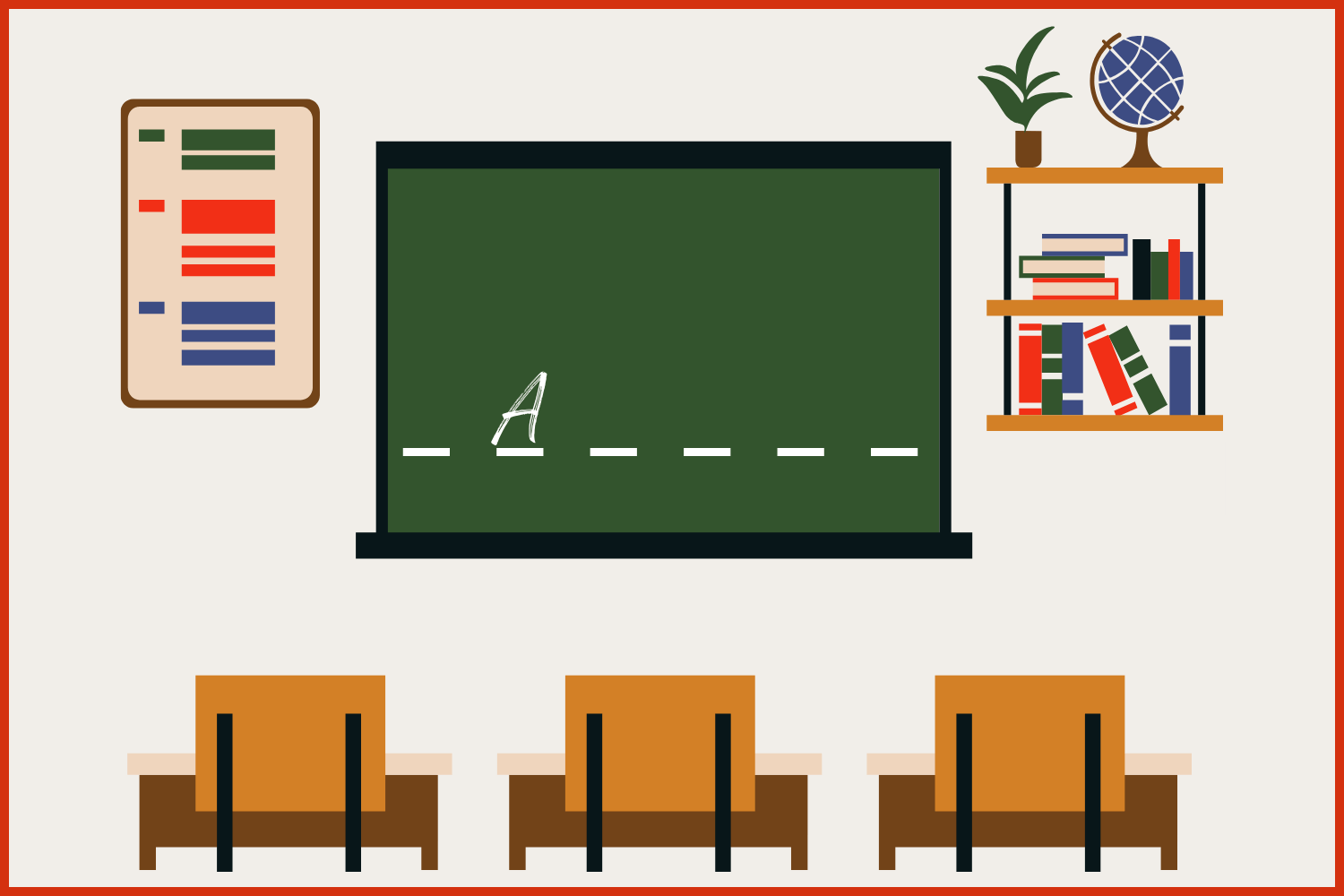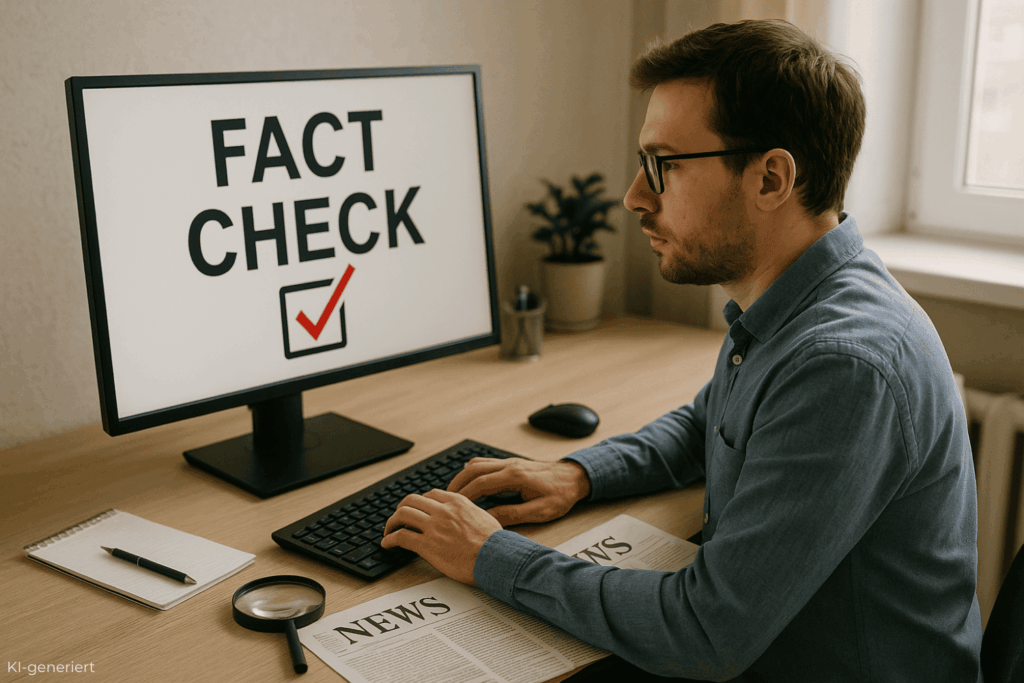Der Deutschkurs G3 aus der Einführungsphase im Schuljahr 2025/26 hat zu dem Bild „Room in New York“ von Edward Hopper aus dem Jahr 1932 Kurzgeschichten geschrieben. Hier dürfen wir einige sehr gelungene Texte veröffentlichen. (Bildnachweis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Room-in-new-york-edward-hopper-1932.jpg, letzter Aufruf: 26.10.2025)
Ein neuer Anfang
Es war Abend. Helen saß am Klavier und spielte ein paar leise Töne. Immer wieder stoppte sie und begann von vorn. Sie wirkte nachdenklich und unruhig. Richard saß im roten Sessel. Die Zeitung in seinen Händen war längst vergessen, er hörte eigentlich nur zu. Nach einer Weile sagte er: „Du spielst heute anders.“
Helen schaute kurz zu ihm: „Ich denke nach. Über uns. Über das, wie es weitergehen soll.“ Richard schwieg erst, dann legte er die Zeitung beiseite: „Und was denkst du?“
Im Zimmer war es still, nur draußen fuhr ein Zug vorbei. Helen seufzte: „Dass wir so nicht weitermachen können. Alles ist jeden Tag gleich.“
Richard nickte langsam: ,,Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir was ändern.“
Helen legte ihre Hände wieder auf die Tasten, spielte aber nicht. „Dann lass uns morgen damit anfangen.“ Für einen Moment lächelte sie. Und Richard tat es auch.
Lesebrille
Es ist ein später Nachmittag in Alberts Büro. Die Strahlen der späten Abendsonne knallen durch das Fenster auf den kleinen Holztisch, an welchem sich Amalias Ehemann befindet. Ihr Blick streift nur für einen Moment zu ihm, obwohl es sich für sie wie eine halbe Ewigkeit anfühlt. Denn Alberts Augen verlassen keinesfalls die Zeitschrift in seiner Hand, während er sich in seinem Sessel etwas hervorbeugt.
„Er scheint wieder seine Brille verlegt zu haben,“ denkt Amalia zu sich. Nach einem flüchtigen Blick zu ihrem sogenannten Ehemann, der sich noch immer kein Stück bewegt hat, um sie in irgendeiner Weise anzuerkennen, erhebt sie sich vom Hocker.
Sie richtet ihr langes rotes Kleid, welches Sie zuvor mit Bedacht ausgewählt hatte. Sie dachte, dass Albert sich möglicherweise darüber freuen würde, aber diese Hoffnung hat sie bereits aufgegeben. Das leise Tapsen ihrer Fußtritte erfüllt den Flur. Ihre Gedanken sind noch immer gefüllt mit absoluter Leere, als sie nach Alberts Lesebrille auf dem Nachttisch greift und sie mit vorsichtigem Bedacht zu ihm bringt.
Sie bleibt direkt vor ihm stehen. „Hier!“
Zum ersten Mal treffen die dunklen Augen von Albert auf die ermüdeten von Amalia. Seine Gesichtszüge bleiben unverändert, als er ihr die Brille abnimmt und sie sich stattdessen aufsetzt.
Mit einem lautlosen Seufzer setzt sich Amalia wieder unaufgefordert auf den Hocker vor dem Klavier.
„Ist etwas?“, erklingt unerwartet Alberts tiefe Stimme. Bei dem Klang muss sie aufzucken. Denn er fragt nicht aus Interesse oder Besorgnis, sondern nur aus Irritation. Das ist zumindest Amalias Gedanke, die als Antwort nur den Kopf schüttelt und sich beschämt umdreht, um mit ihren Fingerkuppen die Tasten des Klaviers zu berühren, denn das tut sie lieber, als sich weiter demütigen zu lassen.
Zwischen den Tönen
Die Töne fielen wie Tropfen auf das runde Tischbein, langsam und unregelmäßig und trotzdem hielten sie den Raum zusammen. Johann saß im Ohrensessel, die Zeitung gefaltet auf den Knien, nicht weil er die Zeilen lesen wollte, sondern weil sich seine Hände daran festhalten konnten. Clara saß am Klavier, das rote Kleid strich wie eine Flamme an ihrem Knie entlang, und ihre Finger tasten die Noten, als suchten sie einen verlorenen Weg. „Spielst du noch einmal?“, fragte Johann seine Ehefrau, ohne den Kopf zu heben. Die Frage war klein, wie ein Kiesel, der in einen großen Wassereimer geworfen wurde. Das Echo blieb aus. Clara beugte sich über das Klavier. Ihr rotes Kleid brannte im Lampenschein, ein leuchtender Fleck in der blassen Stube. Ihre Finger bewegten sich tastend, stolpernd, dann wieder fließend, als suchen sie einen Weg, der nicht auf der Notenzeile stand.
„Es ist spät“, murmelte Johann, kaum lauter als das Umblättern einer Seite. Seine Finger legten sich um die Zeitung so, als wollte er sie schützen, oder sich selbst. Er warf die Seite weiter, als könnte das Papier ihm Antworten geben. Die Worte waren scharfe Dinge, Zahlen und Namen, aber sie schnitten nicht so tief wie Stille.
Er erinnerte sich an die Jahre, in denen sie an Sonntagen zusammen am Klavier gesessen hatten: Er, der von der Arbeit kam, und sie, die eine Melodie übte, und dann beide, die lachten, als kämen die Töne von irgendwoher und landeten wie Schmetterlinge auf ihren Köpfen. Jetzt landeten sie auf dem Holz des Tisches und rollten auseinander. Ein schiefer Ton platzte in die Stille, blieb zwischen ihnen hängen wie ein unausgesprochenes Wort. Sie ließ die Hände nicht ruhen, sondern spielte weiter, härter, dann wieder leiser, beinahe zärtlich. Johann schob die Zeitung vom Schoß. Das dumpfe Geräusch auf dem Tisch klang wie ein Schlussstrich, den er nicht ziehen wollten. Er sah zu ihr hinüber. Ihr Rücken war geradezu gerade, als müsste er etwas tragen, das man nicht sehen konnte.
„Manchmal hilft es“, flüsterte Clara, ohne den Blick vom Notenblatt zu lösen, „wenn man spielt. Statt zu reden.“ Johann trat ein Stück näher. Sein Schatten legte sich über die Tasten, doch sie wich ihm nicht aus. Für einen Atemzug schien sie aufzusehen, nur ein Winkel ihrer Augen, und er hielt den Blick, als wäre dort etwas, das er lange gesucht hatte. Dann ließ Clara ihre Finger wieder sinken. Ein neuer Akkord erklang, klar, fast schmerzhaft schön. Johann legte die Hand auf den Deckel des Klaviers. Er sagte nichts. Clara spielte weiter und zwischen den Tönen lag das, was sie einander nicht mehr sagten. Das Fenster stand offen, während die Nacht draußen vorbeizog.
Wie eine Witwe
Der Abend war vom Schweigen schwer. Nur das Ticken der Uhr an der Wand und das Rascheln der Zeitung, die George vor sein Gesicht hielt, tönten in die Stille hinein. Mary saß am Klavier, ließ ein paar Töne wie Steine in einen Brunnen fallen. Sie versickerten im Nichts.
„Du siehst mich gar nicht mehr an“, sagte sie leise. George blätterte weiter. „Ich sitz doch hier, oder?“ „Hier vielleicht. Aber nicht bei mir.“ Langsam senkte er die Zeitung, seine Augen müde, gerötet vom Fabrikstaub. „Immer dieses Gerede. Ich arbeite mich kaputt, und du suchst nur Fehler.“
„Es sind keine Fehler.“ Marys Finger zitterten über den Tasten. „Es ist die Leere. Ich rede und es kommt nichts zurück.“ Er schnaubte. „Leere? Du hast ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch. weißt du, wie viele Frauen allein sind, weil ihre Männer an der Front sterben?“ „Und was habe ich davon?“ Ihre Stimme wurde fester, schärfer. „Mein Mann sitzt hier, atmet dieselbe Luft – und ich fühle mich trotzdem wie eine Witwe.“ Stille. Nur die Uhr schlug, unerbittlich. George knüllte die Zeitung, als könnte er sie zerdrücken wie den Vorwurf selbst. „Also bin ich schuld. Immer ich.“ „Du hörst nicht zu!“ „Weil du immer nur klagst!“ Er stand auf, das Knarzen des Sessels erklang laut im Raum. „Du machst aus allem eine Anklage!“
Ihre Hände zitterten über den Tasten. „Ich will doch nur, dass du mich siehst!“ Seine Lippen öffneten sich, schlossen sich wieder, zwischen ihnen der Tisch übersät mit Zeitungsseiten, Notenblättern, Staub – wie eine Grenze. Draußen rollte ein Güterzug vorbei, das Dröhnen schwall an, verschluckte ihre Stimmen. Als die Laute verklangen, war es wieder still. George griff nach der zerknitterten Zeitung. Mary legte die Hände in den Schoß. Zwei Menschen, einen Atemzug voneinander entfernt – und doch Welten getrennt.
Die Fliege
Eine Fliege strampelte im Gin-Glas um ihr Leben. Gerade war sie noch auf dem Rand spaziert, doch rasch verlor sie den Halt und glitt in die durchsichtige hochprozentige Flüssigkeit. Es würde nicht lange dauern, bis sich der Chinin-Körper vollgesogen hatte und unterging. Angeekelt betrachtete sie das Glas, doch sie konnte den Blick nicht abwenden, sie sah dem Tier beim qualvollen Sterben zu.
Wie jeden Abend saßen die beiden hier in diesem stickigen kleinen Zimmer mitten in der riesigen Stadt. Sie am Klavier, er in die Zeitung vertieft, gelbe Wände, einfache Bilder, Holztisch, Sessel – beisammen und doch ewig weit entfernt.
Etwas hatte sich verändert in den Jahren, das spürten sie beide. Sie freute sich noch immer, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, doch nach und nach ging die Aufmerksamkeit verloren. Hatte er anfangs noch oft Blumen oder Konfekt mitgebracht, wich das irgendwann einem schnell dahingehauchten Kuss, bis nur noch ein kurzes „Hallo“ ausgetauscht wurde.
Mit der Aufmerksamkeit gingen auch die Träume verloren. Beide wollten anfangs eine Familie, doch nicht hier in der Stadt. „Hier ist kein Platz für Kinder“, pflegte er immer zu sagen, „wir haben doch noch Zeit“. Doch dann kam die Krankheit und die Operation und die Ärzte, die meinten, dass keine Kinder mehr möglich seien. Dann kam die Traurigkeit, die tiefe Traurigkeit, aus der es kein Entkommen zu geben schien – und dann kam der Gin, der Linderung versprach, aber nur scheinbar, denn nachts wachte sie schweißgebadet voller Albträume auf. Er durfte es nicht wissen, ein Glas am Abend – das war in Ordnung, das war gesellig und passte zu seinem Whiskey. Aber die zwei Flaschen über den Tag verteilt, die durfte er nicht finden. Deswegen versteckte sie sie im Klavierkasten, auch jetzt. Morgen, wenn er zur Arbeit ginge, würde sie die Flaschen wegbringen und sich neue holen, wie jeden Tag.
Sie nahm das Glas mit der toten Fliege und ging in die Küche. „Willst du noch einen Whiskey, Schatz?“, fragte sie hochkonzentriert, um nicht zu lallen. „Nein, ich habe noch“, antwortete er. Sie füllte ihr Glas erneut bis zum Rand und sah, wie die Fliege langsam im Abfluss verschwand.